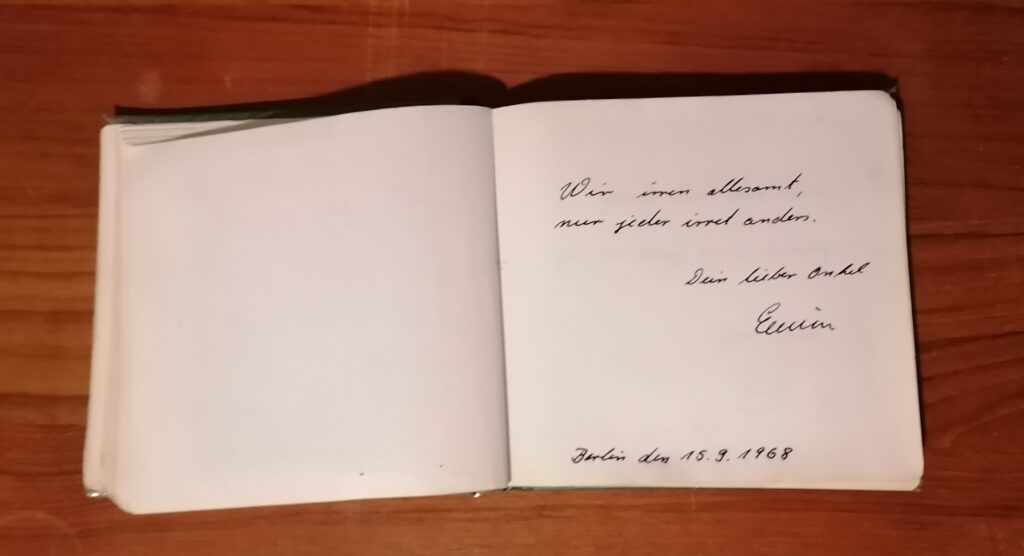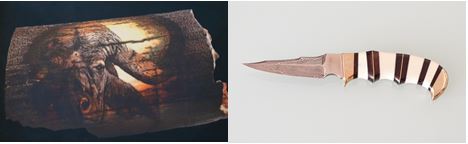Panta rhei – steht im WhatsApp Status einer guten Freundin. „Alles fließt“ bedeutet das wörtlich übersetzt. Der griechischer Philosoph Heraklit wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sich alles ständig verändert. Eine schöne Vorstellung und ja, ich schau gern auf den dahinfließenden Rhein, auf die kommenden und gehenden Wasser am Meer oder auf den sprudelnden Gebirgsbach …. ich finde es schön, dass ich nicht mehr die bin, die ich einmal war.
Momentan allerdings, Stand Februar 2021 empfinde ich diesen Spruch als Hohn, wann immer er mir unter die Augen kommt. Momentan, wo sich ein Tag kaum vom anderen unterscheidet, wo es keine Highlights gibt. „Die Zeit plätschert so vor sich hin“ könnte man sagen. Aber das wäre beschönigend. Mir scheint, die Zeit steht still. Still wie Wasser in einer Pfütze, abgestanden, und sobald es wärmer wird, wird es vor sich hin modern. Still wie das Wasser, das knöcheltief auf meinem Balkon steht, zusammen mit ein paar letzten Schneeresten.

Moment mal!
Die Zeit als abgestandene Pfütze ist nicht im Fluss
Ich habe doch einen Ablauf im Balkonboden. Mit dem stimmt anscheinend etwas nicht. Der ist – optisch gesehen – frei. Kein Laub oder andere Pflanzenreste verstopfen ihn. Bleibt nur Eis im Inneren. *grübel grübel* Ja! Ich erinnere mich an die Tränken für die Kälber vor nicht ganz einem halben Jahrhundert. Der Winter meines Landwirtschafts-Praktikums war noch kälter als dieser im Jahr 2021 und vor allem länger kälter. Täglich mussten wir Anstrengungen unternehmen, damit die Kälber mit ihren großen schwarzen Augen und den staksigen Bewegungen etwas zutrinken bekamen. Laut muhten sie, wenn wir mit den Eimern voll heißem Wasser anrückten, mit dem wir die Schläuche auftauten. Anschließend stürzten sie sich gierig auf die Tränken.
Von der abgestandenen Pfütze zum verstopften Ablauf
Also stelle ich jetzt schnell meinen Wasserkocher an, schütte die blubbernde heiße Flüssigkeit in den Ablauf und kann beobachten, wie langsam Bewegung in das Wasser kommt, unmerklich zunächst, bis es schließlich einen kleinen unscheinbaren Strudel bildet und in der Tiefe verschwindet. Es steht also doch nicht still und ich bin zufrieden. Denn Wasser knöcheltief auf einem Balkon mit Fliesenbelag, das wäre dem auf Dauer nicht gut bekommen.
Die Wärme bringt das Eis zum Schmelzen und das Wasser zum Ablauf
Aber: War das schon ein Highlight? Nein. Irgendwie nicht.
Noch einmal lasse ich den Tag Revue passieren. Und da fällt mir ein: Da war was! Heute ging ich ausnahmsweise mal wieder Richtung Bahnhof und kam an der Filiale der Bäckereikette vorbei, bei der ich nie einkaufe. Und da sah ich die beiden jungen Männer wieder, die dort arbeiten. Einer bediente eine Kundin, der andere reparierte die Uhr an der Wand. Beide bemerkten mich und beide lächelten mich an, so wie sie es immer tun, wenn ich zum Bahnhof strebe und sie mich bemerken. Und ich konnte zurück lächeln. Das war schön. Ich glaube, das ist es, was mir fehlt – weil ich im Homeoffice arbeite, gehe ich zurzeit nicht mehr Richtung Bahnhof.

Wenn ich mich bewege, sieht die Welt anders aus
Vielleicht sollte ich es öfter tun. Einfach ohne zum Bahnhof zu müssen. Einfach am Bäckereigeschäft vorbei eine Runde um den Block gehen, ein Lächeln abholen, ein Lächeln schenken und schon sieht der Tag ganz anders aus.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Kraft dazu reicht. Sie ist schon ziemlich abgestanden. Ich hoffe, sie fängt nicht an zu modern wenn es wärmer wird.