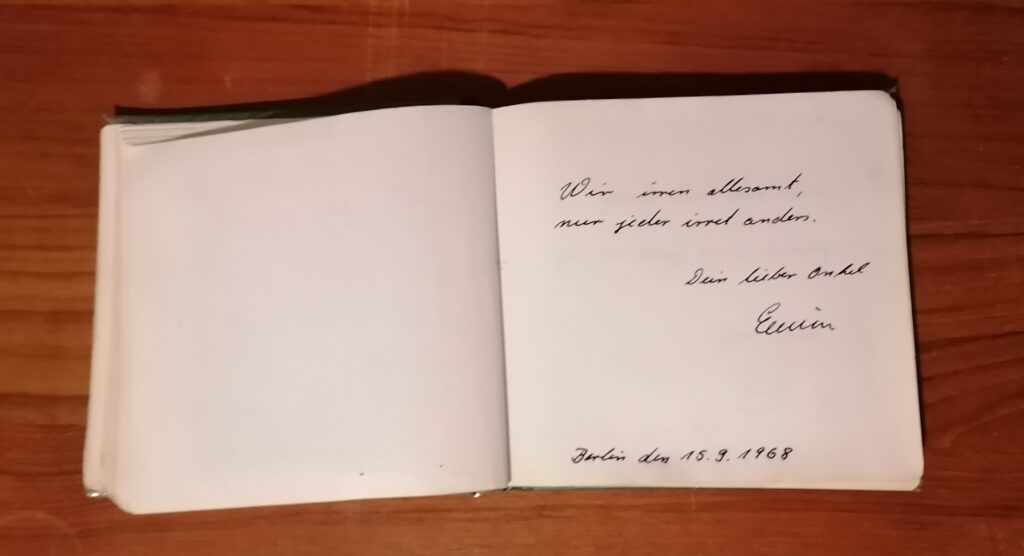… bleib’ ich zuhaus’ und stricke socken
Okay. Jetzt kommt das nächste Outing. Ich stricke. Handarbeiten mochte ich eigentlich nicht so gern. Von meiner Mutter bekam ich nämlich immer den Satz zu hören: „Wenn die bösen Buben locken, bleib zuhaus‘ und stopfe Socken – was sich mühelos umwandeln ließ zu „… stricke Socken.“ Ich wollte lieber was erleben. Und nicht zuhause rumhocken, um mir womöglich von meiner Oma „gute Ratschläge“ geben zu lassen. Die hatte nämlich das Monopol aufs Socken stricken und ihre Monopole verteidigte sie immer mit Klauen und Zähnen. Sprich: mit Spott und Häme. Den bekam ich ab, wenn ich etwas nicht auf Anhieb schaffte. Heute, wo man zuhause bleiben muss und soll, bin ich natürlich unglaublich froh um dieses Hobby.
Geduld mit den Kunden
Angefangen habe ich es vor zirka drei Jahren, seit ich am Telefon arbeite, im technischen Support. Grob gesagt: Ich erkläre den Kunden, wie sie eine Software bedienen müssen. „Jetzt klicken Sie bitte dahin.“ – Kann ich nicht. Gibt es nicht.“ – „Schauen Sie bitte mal oben am Rand. Was sehen Sie da?“ – „Das und das und das.“ – „Also, und eine Zeile drüber?“ – „Ja, tatsächlich“ … „Ach wunderbar, jetzt funktioniert es wieder, vielen Dank.“
So laufen diese Gespräche meist. Aber das, was ich da mit den drei Punkten angedeutet habe, das kann sich ziehen. Und auch bis „Ja, tatsächlich“, dauert es bisweilen. Da heißt es Geduld bewahren, ruhig bleiben, wo ich den Kunden bisweilen am liebsten mit der Nase hin stupsen würde! Eine echte Herausforderung, denn erschwerend kommt hinzu, dass wir uns nicht bewegen können. Wir sind ja mit unserem Headset am Arbeitsplatz festgekettet, die Leine ist sehr kurz und ich habe notorischen Bewegungsdrang.
Irgendwann sah ich eine Kollegin mit einem Häkelzeug …
… und machte mich ans Stricken. Dann können sich auch meine Hände bewegen und nicht nur mein Mund. Natürlich nur einfache Sachen, bei denen man nicht denken muss, sonst mache ich zu viele Fehler, meine Aufmerksamkeit ist ja bei den Kunden. Anfangs war ich sogar bei französischem Patent überfordert, aber man bekommt Routine. Inzwischen kann ich sogar Socken stricken bei der Arbeit. Anfangs habe ich Ferse und Spitze in der Freizeit gestrickt, inzwischen geht das so von der Hand. Omas Aversionen sind mir egal, für Socken finde ich immer dankbare Abnehmer. Und die Geduld mit meinen Kunden wächst wirklich stetig. Schließlich mache ich auch für jedes Paar Socken mindestens 16000 Mal die gleiche Bewegung und bin mir sicher, dass ich irgendwann fertig werde.
Die Freude beim Aufribbeln
Aber nicht nur die Geduld mit meinen Kunden wächst. Auch mit mir. Dabei neige ich eigentlich zu cholerischen Anfällen. Zumindest verschiebe ich die Vollendung von Projekten, die nicht sofort klappen, gern auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, den man in keinem Heiligen-Kalender findet. Inzwischen ribble ich sogar. Ohne auf die Idee zu kommen, dass das verschwendete Zeit sei. Daran ist meine Teamleiterin schuld. Sie hatte nichts gegen meine Nebentätigkeit, weil sie in der Zeit, als noch selbst telefonierte, auch gestrickt hat. Jetzt kommt sie immer mal wieder mit neuen, wunderschönen Pullovern in die Arbeit, die sie natürlich in der Freizeit fertigen muss.
Ich habe inzwischen auch mehr Geduld mit mir
Von ihr stammte der Hinweis auf einen Blog, auf dem die Strickerin dafür plädiert, mit Freude aufzuribbeln. Davon wollte ich anfangs nichts hören. Ich war davon überzeugt, dass ich alle Projekte auf Anhieb zu meiner vollsten Zufriedenheit durchziehe. Tja, war dann nicht so. Und ist noch immer nicht so. Aber sogar aus der ersten Wolle, die ich mir billig im Internet gekauft hatte, weil ich ja nicht wusste, ob ich überhaupt Spaß dran finde, habe ich inzwischen einen ganz passablem Schal gestrickt. Zweimal habe ich geribbelt und der Flauschanteil der Wolle ging allmählich gegen Null. Bis zum zweiten und dritten Anlauf habe ich mir auch Zeit gelassen, zwischendurch etwas anderes gestrickt und die dort gesammelten Erfahrungen mit eingebracht.
Wichtige Erfahrungen sammelte ich beim Stricken
Und diese Erfahrung, die ist wichtig:
dass ich nicht sofort verzagen muss, etwas nicht auf Anhieb klappt – denn eigentlich bin ich verzagt, auch wenn sich das in wenn einen cholerischen Anfall äußert.
dass auch keiner deswegen lästert.
Und diese Erfahrung, die ist gut. Die übertrage ich auch auf andere Projekte. Putzen beispielsweise. Steuererklärung. Ich bin mir sicher, dass ich das rechtzeitig hinbekomme ohne in Hektik zu verfallen. Ehrlich, das ist toll. Und ich weiß nicht. Ob ich diese Erfahrung mit den bösen Buben auch hätte machen können. Abgesehen davon, dass sie momentan auch nicht draußen unterwegs sind.